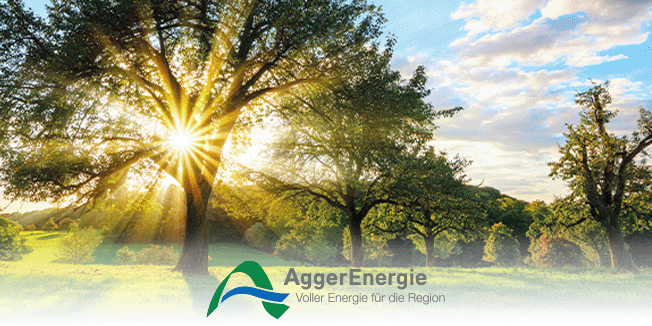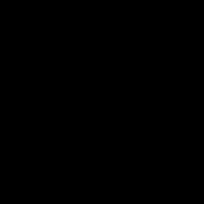Bilder: privat --- Am Maidan, dem Ort der ukrainischen Revolution, werden die Pflastersteine neu verlegt.
ARCHIV
Ein Jahr Kiew: Ohne Ende kein Neuanfang
Nümbrecht Die Nümbrechterin Elena Rother absolviert einen einjährigen Freiwilligendienst in einem Kinderheim in der Ukraine Auf OA schildert sie ihre Erlebnisse und Erfahrungen.
Liebe Leser,wir kommen aus der Metrostation Olympiska heraus und holen tief Luft. Schon seit über drei Wochen knallt die Sonne erbarmungslos auf Kiews Pflaster: 35 °C und in der Metro ist es noch wärmer und stickiger. Corny, eine weitere Freiwillige und ich sind auf der Suche nach der Kiewer Festung - laut primetour.com die größte Erdfestung Europas, die nur wenige Gehminuten vom Stadion entfernt liegen soll und bei GoogleEarth nicht zu übersehen war. Doch auch nachdem wir eine Runde um das gigantische Stadion gedreht haben, fehlt von der Festung jede Spur. In der Mittagshitze sind wenige Menschen auf den Straßen unterwegs, die Bushaltestelle, an der ein Stadtplan hängt, ist unser Lichtblick. Obwohl dort nur ein Stück der Straße, in der sich die Festung befinden soll, eingezeichnet ist, machen wir uns motiviert auf den Weg.
Als wir am Fuße eines Berges stehen, schwindet unsere Begeisterung jedoch rasant. Zweifelnd, ob sich auf dem Berg wirklich unser Ziel befindet, fragen wir einen jungen Mann nach dem Weg. Er erklärt uns auf Englisch, dass er auch nicht aus Kiew kommt, macht aber bereitwillig sein Handy an und zeigt uns einen Stadtplan: Wir sind richtig. Oben angekommen fehlt von der Festung jedoch jede Spur und die Straße, die wir nehmen sollen, führt den Berg wieder hinab. 800 Meter sind es - laut Google - noch. Wir entscheiden uns, ein Taxi zu nehmen: Die Fahrer müssen ja wissen, wo die Hospitalnajastraße liegt. Über den Zaun einer Schule ragen die Zweige eines Mirabellenbaumes, wir lassen uns die Früchte schmecken, während wir auf unser Taxi warten.

[Elena (Mitte) während einer Bootsfahrt auf dem Ros.]
Schließlich kommt es, wir steigen ein und fahren den gesamten Weg bis zum Stadion zurück. Jetzt ruft der Fahrer seinen Freund an und fragt ihn nach dem Weg. Dieser führt durch den Nachmittagsverkehr der Innenstadt einen anderen Berg hinauf. Mitten in einem Wohnbezirk hält das Auto an. Der Fahrer erklärt mir, dass wir zwar bei Hausnummer 21, nicht aber 21b sind. Das mag für westeuropäische Ohren nach einem Fußweg von maximal einer halben Minute klingen, hier kann es durchaus bedeuten, dass man ganze Wohnblocks umrunden muss, um über irgendeinen versteckten Hinterhofeingang zur richtigen Haustür zu gelangen. Für Ukrainer stellt das gewöhnlich kein Problem dar, weil sie das Prinzip des alten, sowjetischen Hausnummerierunungs-Systems durchschaut haben. Für mich ist es jedoch auch nach einem Jahr in Kiew noch nicht ganz durchsichtig geworden, vor allem nicht in einem Viertel, in dem ich noch nie war.
Ich frage den Fahrer nach dem Museum, er zuckt ratlos mit den Schultern, ruft dann aber erneut seinen Kumpel an und ein paar Straßen weiter finden wir schließlich unser Ziel. Die riesige Festungs- und Kasernenanlage dürfte eigentlich nicht zu übersehen sein, ist aber vielen Einwohnern gänzlich unbekannt und wird von blickdichten Bäumen umgeben. Wir gehen auf den Haupteingang zu als eine Frau aus dem Fenster schaut, uns zu sich ruft und bittet, ihr beim Schließen des Fensters zu helfen. Am Haupteingang steht Poliklinik. Vor dem halbkreisförmigen Gebäude sind alte Kanonen aufgebaut. Die Tür ist verschlossen. Gegenüber der Klinik ist ein Erdwall mit Graben, an der Brücke stehen zwei junge, bewaffnete Soldaten und starren uns an. Wir nehmen unseren Mut zusammen, gehen auf sie zu und fragen nach dem Museum. Sie erklären uns freundlich den Weg.

[Der Andreasstieg in Kiew.]
Als wir ein Stück um die Wallanlage herum gehen, sehen wir dann tatsächlich den Eingang. Ein Denkmal erinnert an den polnischen Aufstand 1863, nach dem die Festung und Kaserne erstmals als Gefängnis diente. Eine ältere Frau drückt mir drei verschiedene Tickets in die Hand und weist auf einen Tunnel. Dieser führt uns unter die Erde in einen großen, kreisförmigen Saal, in dem Vitrinen mit alten Dokumenten, Ansteckern, Uniformen und Fotos stehen. Leider sind die Ausstellungsgegenstände bestenfalls in Ukrainisch und Polnisch beschriftet. Zwei der ehemaligen Gefängniszellen kann man noch sehen und außerdem gibt es einen riesigen Raum mit einer Munitions- und Waffenausstellung. Am Ende der Ausstellung finden wir einige Schriftstücke, die wir lesen können: Die Rote Armee wirbt bei deutschen Soldaten dafür, sich in sowjetische Kriegsgefangenschaft zu begeben, anstatt weiterhin Hitler zu dienen. Zur Geschichte der Festung selber gibt es keine Informationen.

[Der Markt in Odessa.]
Wieder am Tageslicht beschließen wir, doch noch den Weg auf den Erdwall zu suchen und fragen erneut unsere bewaffneten Freunde, die uns ins Innere der Festung lassen. Von hier aus gelangt man auf den Wall, wo noch ein paar weitere alte Kanonen stehen und man einen schönen Blick auf die Festung, die Stadt und das Olympiastadion hat. Im Innenhof der riesigen Anlage befindet sich ein Krankenhaus, das aus diversen Gebäuden besteht, die mit liebevoll angelegten Blumenbeeten umgeben und auf großen Wegweisern übersichtlich ausgeschildert sind. Zwei Männer in Operationskitteln stehen vor der Tür und rauchen, ein paar Krankenschwestern sind damit beschäftigt, jemanden aus dem Krankenwagen und auf eine klapprige Trage zu befördern. Als wir uns vor dem Ausgangstor nochmal umdrehen wird klar, warum der Gebäudekomplex bewacht wird. Wir hatten keine gewöhnliche Poliklinik, sondern das ukrainische Militärkrankenhaus durchquert. Hätten wir danach gefragt, hätten uns bestimmt mehr Leute mit einer Wegbeschreibung weiterhelfen können...

[Die Kiewer Festung.]
Gerade als wir mein Lieblingscafé erreichen, beginnt es zu regnen und prompt sind alle Tische drinnen besetzt. Zwei junge Männer winken uns zu sich, etwas zögernd folgen wir ihrer Einladung und setzen uns dazu. Sofort beginnen sie ein Gespräch: Wir beide kommen aus dem Donezker Oblast. Zum Glück haben wir vor kurzem Arbeit in Kiew gefunden. Eingezogen wurden wir nicht, weil wir kaum militärisch ausgebildet sind, aber natürlich unterstützen wir die ukrainische Armee mit allem, was wir geben können... Das klingt schon fast nach einer Rechtfertigung. Wann immer ich mit Ukrainern ins Gespräch komme, fällt das Thema auf den Maidan und die Politik. Der Krieg im Osten ist das, was hier momentan alle zu beschäftigen scheint und das ist nicht verwunderlich: Jeder hat Freunde oder Verwandte, die in der Ostukraine leben oder vom Militär dorthin beordert wurden.

[Das Opernhaus in Odessa.]
Der Maidan sieht jedoch inzwischen wieder fast so aus wie bei meiner Ankunft in Kiew. Die Zelte wurden abgebaut und die Pflastersteine werden neu verlegt. Auf den ersten Blick scheint alles wieder normal zu sein. Wie so oft in der Ukraine genügt aber ein zweiter Blick, um zu erkennen, wie es hinter der Fassade aussieht. Am Haus der Gewerkschaften prangt ein riesiger Werbebanner in den ukrainischen Nationalfarben, ebenso am noch nicht fertig gebauten Einkaufszentrum ZUM. Bei letzterem wird lediglich eine Baustelle verdeckt, bei ersterem die schwarz-verkohlte Ruine des neoklassizistischen Gebäudes aus der Breschnew-Ära, in der Schätzungen zufolge bis zu 300 Menschen während den Ausschreitungen verbrannten.
Ein Jahr in Kiew liegt nun hinter mir. Eine spannende Zeit zwischen Projekten, Großstadtleben, Arbeit mit den Kindern, Reisen und Revolution. In weniger als drei Wochen werde ich zurück nach Deutschland fliegen, einige Tage zu Hause genießen, dann zum Auswertungsseminar meiner Entsendeorganisation, Pax Christi, nach Belgien und Aachen fahren und nur wenige Wochen später mein Studium beginnen. Noch realisiere ich das kaum und auch wenn die Tage wie im Flug vergehen, genieße ich jeden einzelnen.

[Eine Souvenirverkäuferin am Maidan.]
Gestern habe ich einen kleinen Fotografier-Spaziergang durchs Wohngebiet gemacht, um noch einmal meine Umgebung festzuhalten. Überall stehen momentan zusätzliche Stände mit Obst und Gemüse, viele Leute verkaufen ihre eigene Ernte privat und sitzen auf Holzkisten oder Zäunen im Park. Die Wassermelonenfrau an der Ecke, die mich noch vom vergangenen Sommer kennt, fragt: Fährst du bald nach Hause und musst jetzt Bilder machen, damit du dich später erinnern kannst? Als ich das bejahe fügt sie hinzu; Du machst es richtig, Mädchen. Alles Gute muss man festhalten! Wenige Meter entfernt sitzt ein Mann, der frischen Honig verkauft. Je nach Bedarf füllt er die gewünschte Menge direkt ins Glas oder gleich in eine Zwei-Liter-Plastikflasche. Auf seinen erstaunten Blick hin erklärt die Frau: Das ist meine Kundin aus Deutschland, sie muss jetzt bald zurück fahren... Sie möchte nicht fotografiert werden, ihre Melonen und die Wespen, die sich darauf niedergelassen haben, aber schon. Ich zeige auf die Melone, die ich kaufen möchte, die Frau gibt mir ein Stück zum Probieren. Leider habe ich kein Kleingeld und die Verkäuferin kann nicht wechseln. - Bring mir das Geld einfach später vorbei!
Auf dem Heimweg treffe ich einen Kollegen, er arbeitet als Psychologe im Kinderheim. Was machst du denn hier? Den Maidan musst du jetzt fotografieren, da sieht es jetzt plötzlich völlig anders aus. Wir gehen ein Stück zusammen. Für mich ist das ein gutes Zeichen, dass sie jetzt die Zelte endlich abgebaut haben. Nur wenn man das Alte beseitigt, kann man Platz für Neues schaffen. Vielleicht gibt es bald wirklich einen Neuanfang für die Ukraine.
Falls Sie noch weitere Berichte von meiner Zeit in der Ukraine lesen möchten, können Sie diese auf meinem Blog www.elenainderukraine.jimdo.de finden. Mit diesem Bericht verabschiede ich mich. Vielen Dank für Ihr Interesse! Bei Fragen rund um einen Freiwilligendienst in Kiew oder Anregungen können Sie über den Blog gerne Kontakt zu mir aufnehmen. Ich würde mich freuen, von Ihnen zu hören!
Ihre
Elena Rother